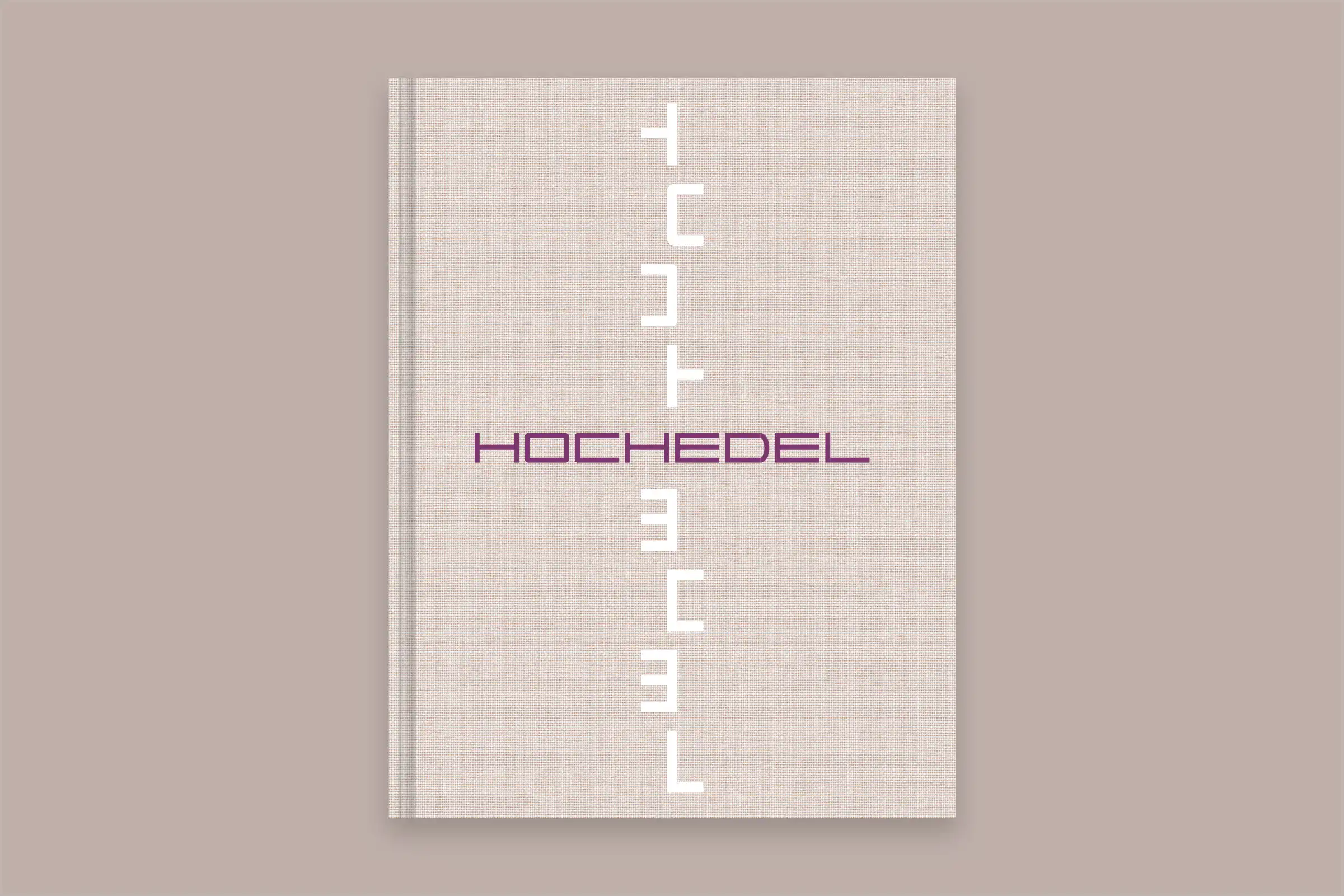Als im November 2018 Ihr Bild Portrait of an Artist (Pool With Two Figures) in New York versteigert wurde, avancierten Sie zum teuersten lebenden Künstler. Haben Sie die neun Minuten lange Auktion verfolgt?
Nein, solche Spektakel interessieren mich nicht.
Die erste Version Ihres 1972 entstandenen Bildes haben Sie nach sechs Monaten vergeblicher Anläufe vernichtet. Aus welchem Grund?
Der Blickwinkel auf den Swimmingpool und das Verhältnis der beiden Figuren zueinander stimmten nicht. Auch bei der Wahl des Hintergrunds war ich unsicher. Ich probierte es mit einer Mauer, mit einer Glaswand und mit Bergen. Die neue Version von Portrait of an Artist zu malen war ein Rennen gegen die Uhr, denn 14 Tage später sollte das Bild in der Galerie von André Emmerich in New York gezeigt werden. Ich arbeitete 18 Stunden am Tag, mit einer Intensität wie nie zuvor.
Portrait of an Artist ist die Darstellung einer traumatischen Trennung. Am Rand des Swimmingpools steht Peter Schlesinger, Ihre erste grosse Liebe, die Sie kurz zuvor verlassen hatte. Unter Wasser schwimmt Schlesingers neuer Freund. Tut das Ende einer Liebe weniger weh, wenn man es gemalt hat?
Ja, wenn eine Trennung zu einem künstlerischen Darstellungsproblem wird, gewinnt man Abstand. Unglück und Traurigkeit werden zu Arbeitsmaterialien, und man schaut sich selbst wie von aussen zu. Nehmen Sie van Gogh. Er liebte das Malen und verbrachte den grössten Teil seines Lebens damit. Er führte also ein Leben der Liebe. Seine Biographen dagegen behaupten, sein Leben hätte aus Einsamkeit, Schmerz und Depression bestanden. Dieses Missverständnis durchzieht fast alle Biographien, die über Künstler geschrieben werden. Warum male ich jeden Tag? Weil es mir nicht besonders gut geht, wenn ich etwas anderes mache.
Wie nah, wie fern ist Ihnen Portrait of an Artist heute?
Die Trennung von Peter Schlesinger liegt 48 Jahre zurück, aber das Bild zeigt etwas, das gestern passiert sein könnte. Wegen dieser Zeitlosigkeit überzeugt mich das Bild bis heute.
Beim Verkauf Ihres Bildes soll getrickst worden sein. Ihr Biograph Christopher Simon Sykes schreibt: «Ein unbekannter Amerikaner kam in die Galerie von André Emmerich und tat so, als sei er mit David Hockney befreundet. Emmerich verkaufte ihm das Bild für 18.000 Dollar. Nach ein paar Monaten war das Bild in den Händen eines Londoner Händlers, der es auf einer Kunstmesse in Deutschland zeigte. Am Ende wurde das Bild von einem Londoner Sammler für fast das Dreifache des New Yorker Preises gekauft.» Kennen Sie diesen Londoner Sammler?
Nein.
Der Londoner Sammler verkaufte Portrait of an Artist für einen unbekannten Preis an David Geffen, einen in Los Angeles lebenden Musik- und Filmproduzenten, dessen Vermögen auf sieben Milliarden Dollar geschätzt wird. Hat Geffen Ihnen mal angeboten, das Bild anzuschauen?
Wir wohnten in den Neunzigern beide in Malibu. Ab und zu besuchte ich ihn, um einen neuen Film anzuschauen. Eines Tages hing mein Bild bei ihm an der Wand. Ein paar Monate später stellte ich meine Besuche bei Geffen ein, weil er genervt davon war, dass meine Hunde auf seine Teppiche pinkelten.
1995 verkaufte Geffen das Bild für einen unbekannten Preis an Joe Lewis, einen britischen Finanzhai, der auf den Bahamas lebt und dessen Vermögen auf 5,2 Milliarden Euro geschätzt wird. Ihm gehören 85 Prozent der Anteile am Fussballclub Tottenham Hotspur, drei Megayachten und eine auf eine Milliarde Euro geschätzte Kunstsammlung mit Werken von Picasso, Matisse, Lucian Freud, Henry Moore und Francis Bacon. Ihr Bild hing angeblich in einem der Salons seiner 98 Meter langen Motoryacht Aviva.
Ich habe diesen Mann nicht kennengelernt. Er hat mir auch nie angeboten, dem Bild ein Besuch abzustatten. Deshalb kann ich nicht sagen, ob das zutrifft.
Als Lewis das Bild vor zwei Jahren vom Auktionshaus Christie’s versteigern liess, betrug das erste Gebot 18 Millionen Dollar, nach 30 Sekunden wurden 50 Millionen geboten. Am Ende zahlte ein anonymer Telefonbieter 90.312.500 Dollar. Ahnen Sie, wer das Bild ersteigert hat?
Nein, ich habe bei Christie’s angerufen und nach der Identität des Käufers gefragt, aber es hiess, man sei zu hundertprozentiger Verschwiegenheit verpflichtet.
Portrait of an Artist gehört zu den intimsten Bildern, die Sie gemalt haben. Kränkt es Sie, wenn Plutokraten sich Ihr Bild als Statussymbol zulegen?
Darüber denke ich nicht nach. Ich bin ein Maler, der das Hier und Jetzt malt und nicht zurückschaut. Nostalgie ist eine uninteressante Geisteshaltung. Ich habe mich in meinem Leben nur ein einziges Mal mit meiner Vergangenheit auseinandergesetzt. Vor vier Jahren habe ich mit dem Buchgestalter Hans Werner Holzwarth die Monographie A Bigger Book zusammengestellt. Das Buch ist 35 Kilogramm schwer und hat eine Spannweite von eineinhalb Metern. Holzwarth und ich sind sechs Monate lang meine Arbeiten aus 60 Jahren durchgegangen. Das war wie eine Psychoanalyse, die mir klarmachte, wie mein künstlerisches Ich sich entwickelt hat. Unser Anspruch an das Buch war, dass sich bei jedem Umblättern einer Seite ein neuer malerischer Aspekt zeigt, und ich denke, das ist uns gelungen. Die Reise durch meine Vergangenheit wühlte mich so auf, dass ich ein halbes Jahr lang ausserstande war zu malen. Das hatte es nie zuvor gegeben. Wie zu Tode betrübt ich auch war, malen konnte ich immer.
Ist es Ihnen wirklich gleichgültig, bei wem Ihre Bilder an der Wand hängen?
Ja, egal, wer gerade der juristische Eigentümer von Portrait of an Artist ist, es ist und bleibt mein Bild. Ich habe es gemalt, mir gehört das Copyright. Das ist, was zählt. Der Eigentümer besitzt bloss ein Stück bemalte Leinwand, das vermutlich früher oder später in andere Hände übergehen wird. Die einzig mögliche Art, ein Bild zu besitzen, ist, es zu malen.
Vor der Auktion verkündete eine Christie’s-Verantwortliche vollmundig: «Wir können selten sagen: 'Das ist die Gelegenheit, das beste Gemälde eines Künstlers zu kaufen.' Hier ist das so.» Teilen Sie diese Expertise?
Nein, das ist leicht durchschaubare PR, die das Auktionsergebnis in die Höhe treiben sollte. Wie sagte Oscar Wilde: «Die einzige Person, welche jede Art von Kunst mag, ist der Auktionator.» Diesen Leuten geht es doch nur um immer noch mehr Geld. Hätte die Christie’s-Frau recht, hätte ich mein bestes Bild bereits vor 48 Jahren gemalt. Was für ein Schlag ins Gesicht! Ich bin weit davon entfernt, Portrait of an Artist für mein Spitzenwerk zu halten.
Überkam Sie ein Triumphgefühl, als Sie von Ihrem Weltrekord hörten?
Nein, «Teuerster lebender Künstler» ist kein Titel, auf den ich aus bin. Ein klein wenig triumphal habe ich mich gefühlt, als A Bigger Book erschien. Dieses Buch war für mich das viel bedeutsamere Ereignis.
Ihr Weltrekord mit Portrait of an Artist hielt gerade mal sechs Monate. Im Mai vergangenen Jahres wurde die Hasenskulptur Rabbit von Jeff Koons für 91,1 Millionen Dollar versteigert. Verfolgen Sie die immer neuen Rekorde auf dem Kunstmarkt?
Weil solche Summen verrückt sind, versuche ich den Kunstmarkt so weit wie möglich zu ignorieren. Das Gute an astronomischen Preisen ist, dass sie einem Bild Schutz und sorgfältige Pflege garantieren. Wer Millionen ausgibt, will, dass sein Anlageobjekt in bestmöglicher Verfassung bleibt, um es zu gegebener Zeit mit maximalem Profit weiterverkaufen zu können. Für den Künstler ist das ein beruhigendes Gefühl. Ich habe meine Bilder von Anfang an so gemalt, dass sie lange leben. Die Farben auf meinen frühen Bildern sehen immer noch gut aus, weil ich schon damals mit Farben umzugehen wusste. Mischt man zum Beispiel zu viel Weiss bei, ändern sich mit den Jahren die Farben.
An wen denken Sie beim Malen?
An niemanden. Ich male meine Bilder ausschliesslich für mich selbst, hoffe aber, dass das, was ich interessant finde, auch für andere interessant ist. Ich würde allerdings auch malen, wenn sich niemand für meine Bilder interessiert. Ohne das Malen wüsste ich nichts mit mir anzufangen und würde mich vollkommen überflüssig fühlen. Nach ein paar Monaten im Sumpf tatenloser Grübelei würde ich verrückt werden. Man kann das als Fluch sehen, das tue ich aber nicht.
Beeinflusst es Ihr Malen zu wissen, dass jeder Quadratzentimeter Leinwand, den Sie mit Farbe bedecken, ein kleines Vermögen wert ist?
Nein, Gier ist mir nicht fremd, aber meine zielt nicht auf Geld, sondern auf erregende Momente. Mein Glück ist, dass es mich glücklich machen kann, wie Regentropfen an einer Fensterscheibe runterlaufen. Sinn und Zweck meiner Bilder sind Vergnügen und Freude. Zu mehr sind sie nicht gedacht.
Wut, Verzweiflung, Leiden, Depression, Krankheit, Tod: Die dunklen Seiten menschlicher Erfahrung kommen in Ihrem Werk kaum vor. Wie erklären Sie das?
Ich nehme es als Kompliment, wenn meine Bilder als allzu spielerisch kritisiert werden. Selbst ein Wissenschaftler im Labor braucht einen Sinn für das Spielerische, um eine Entdeckung zu machen. Ohne Spiel gibt es keine Kunst.
Werden Sie nach der Höhe Ihres Vermögens gefragt, winken Sie ab und sagen, Geld interessiere Sie nicht, da Sie schon mit Mitte 20 «restaurantreich» gewesen seien. Was meinen Sie mit diesem Begriff?
Ich ass jeden Tag in Restaurants und war nicht gezwungen, das billigste Gericht auf der Karte zu bestellen. Wenn mir nach Lobster und Kaviar zumute war, bestellte ich eben Lobster und Kaviar. Deshalb fühle ich mich schon seit 60 Jahren reich. Seit Anfang 20 verbringe ich jeden Tag meines Lebens exakt so, wie ich es will. Wie viele Leute kennen Sie, die das von sich sagen könnten?
Ihr deutscher Kollege Gerhard Richter – sein Vermögen wird auf 550 Millionen Euro geschätzt – sagte kürzlich mit einer Mischung aus Traurigkeit und Wut: «Es ist nicht fair, wenn ein Bild mehr kostet als ein Haus.» Stimmen Sie ihm zu?
Das teuerste Bild in meiner ersten Ausstellung kostete 300 Pfund. Jeder Lehrer oder Rechtsanwalt hätte es sich leisten können und wäre heute reich. Deshalb finde ich es sinnlos, den Preis eines Kunstwerkes für fair oder unfair zu halten.
Der Verleger und Kunstsammler Benedikt Taschen wurde vor zwei Jahren vom Magazin Robb Report gefragt, welcher Künstler ihn am meisten auf die Folter gespannt habe. Seine Antwort lautete: «David Hockney ist mein Freund und Nachbar. Ich besuche ihn zweimal in der Woche. Vor ein paar Jahren begann er ein Bild zu malen, von dem ich schnell wusste, dass ich es unbedingt haben wollte. Als er nach zwölf Monaten fertig war, bat ich ihn es mir zu verkaufen. Er schüttelte den Kopf und sagte: 'Ich liebe meine Bilder, und Gott sei Dank bin ich inzwischen vermögend genug, sie nicht mehr verkaufen zu müssen.' Es begann ein Spiel zwischen uns, halb Spass, halb Ernst. Nach zwei Jahren hat er mir das Bild dann schliesslich doch noch verkauft.» Um welches Bild ging es?
Garden with Blue Terrace.
Das Bild zeigt den Blick von der blau gestrichenen Terrasse Ihres Hauses in den Garten. Was musste Taschen dafür auf den Tisch legen?
Vielleicht zwei Millionen Dollar. Genau weiss ich es nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein Freundschaftspreis.
Ihr 1994 verstorbener Lebensfreund Henry Geldzahler zerriss Ihre Bilder, wenn er sie misslungen fand. Wer darf Sie, das lebende Denkmal, heute noch kritisieren?
Ich vermisse Henry, den Menschen und sein untrügliches Auge. Meine Assistenten könnten theoretisch sagen: «David, dein neues Bild ist dir nicht so ganz gelungen». Aber ist das der Job, für den ich sie bezahle? Ich denke, ich bin mein bester Kritiker. Ich lese immer wieder, ich sei ein höchst produktiver Maler, aber das stimmt nicht. Vergangenes Jahr habe ich neben Zeichnungen höchstens ein Dutzend Bilder gemalt.
Wünschten Sie, es wären mehr?
Nein, ich bin 82 und kann in der nächsten Minute tot umfallen, aber wäre es so, hätte ich in der Kunst mehr Spuren hinterlassen als die meisten Maler.
Künstler, deren Imaginationskraft schwindet, beginnen auch das zu veröffentlichen, was sie zu besseren Zeiten verworfen hätten. Werden Sie im Alter selbstkritischer oder selbstgefälliger?
Selbstkritischer. Auch aus diesem Grund behalte ich seit 20, 30 Jahren mehr als die Hälfte meiner Bilder für mich. Wie gesagt, ich bin mein schärfster Kritiker, und dieser Kritiker ist sich manchmal nicht ganz sicher, wie viel ein Bild von mir taugt.
Versagensangst, nicht weiterwissen, Blockaden: Kennen Sie das?
Nein, wenn Sie sich wie ich jeden Morgen an die Arbeit machen, löst sich jedes malerische Problem früher oder später in Luft auf.
Ihrer Stiftung gehören mehr als 8000 Hockney-Werke. Was passiert mit denen nach Ihrem Tod?
Darüber habe ich noch nicht entschieden.
Da Sie keine Kinder haben, liegt es nahe, Ihre Sammlung einem Museum zu stiften.
Der Vorteil an Museen ist, sie dürfen Bilder nicht gewinnbringend weiterkaufen. Der Nachteil ist, die meisten Werke verschwinden auf Nimmerwiedersehen in lichtlosen Depots. Für einen Künstler aber ist Vergessen werden noch kränkender als Sterben.
Reich gewordene Maler wie Julian Schnabel kaufen eigene Bilder zurück. Sie auch?
Mal eben 90 Millionen Dollar für einen Hockney hinzublättern übersteigt meine Möglichkeiten. Erstickte ich in Geld, würde ich gern Play Within a Playaus dem Jahr 1963 zurückkaufen.
In einem vom Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner geführten Interview wurde der Kunsthändler Larry Gagosian gefragt, ob der Gigantismus in seiner Branche immer so weitergehen wird. Gagosian antwortete: »Bei Basketballspielern sagt man, alles über 2,10 Meter ist nicht mehr gut.» Können Sie diesen Orakelsatz deuten?
Ich kenne Larry seit 45 Jahren. 1975 verkaufte er noch Poster mit Kitschmotiven in einem Hinterhof in Westwood, heute ist er der mächtigste Kunsthändler der Welt. Man muss sagen, dass er ausgezeichnete Ausstellungen und Kataloge macht, aber fragen Sie mich nicht, ob der Kunstmarkt bei 2,09 oder 2,11 Metern angekommen ist und wir auf das Platzen einer Blase zusteuern. Ein Rembrandt war auch zu Lebzeiten von Rembrandt schon teuer, aber bedauerlicherweise ist heute der Preis eines Kunstwerks wichtiger als sein Wert. In Museen bildet sich die längste Schlange vor dem teuersten Bild. Viele Besucher kommen nicht wegen der Kunst, sondern um einen Riesenhaufen Geld anzugaffen.
Auch wer sich nicht für Malerei interessierte, wusste spätestens Ende der Sechziger, wer David Hockney ist. Wie sind Ihnen mehr als 50 Jahre Startum bekommen?
Auch im bescheidensten Künstler hämmert das Verlangen, dass seine Arbeit von möglichst vielen gesehen wird, denn Kunst hat mit Teilen zu tun. Ich wäre kein Künstler, würde ich meine Wahrnehmungen und Gedanken nicht mit anderen teilen wollen. Ich bin aber keiner, der es insgeheim geniesst, wenn seine privaten Belange ins Scheinwerferlicht gezerrt werden. Meine Bilder gehören in die Öffentlichkeit, nicht ich.
1990 lehnten Sie es ab, in Ihrer Heimat zum Ritter geschlagen zu werden, weil Sie, so formulierten Sie es, kein «Sir Somebody» sein wollten. Was, wenn der königliche Palast Sie morgen um ein Porträt von Elizabeth II. bittet?
Sie ist eine erstaunliche Frau – und eine Prüfung für jeden Porträtmaler. Ich wüsste nicht, wie man eine königliche Person wie sie malen sollte. Sie hat Majestät, aber wie malt man im Jahr 2020 Majestät? Würde ich die Königin malen, würde das Bild in jeder Zeitung gedruckt werden. Lucian Freud hat diesen Rummel erlebt, als er 2001 sein Bild HM Queen Elizabeth II vorstellte. Das erspare ich mir.
Weltruhm, Besucherrekorde bei Ausstellungen, unstrittige Reputation bei Kunstkritikern, Vermögen: Sie haben so ziemlich alles erreicht, wovon Künstler träumen. Wäre ein Porträt Ihrer Königin für Sie nicht die letzte grosse Herausforderung?
Wahrscheinlich ja, aber das Bild würde mich für Monate absorbieren und ich habe mir bereits etwas anderes vorgenommen. Vor zwei Jahren habe ich ein Haus in der Nähe von Pont-l’Évêque in der Normandie gekauft. Dort werde ich die nächsten Monate verbringen, um die Ankunft des Frühlings zu malen. In der Normandie kommen keine Besucher zu mir, deshalb bin ich dort dreimal so produktiv. Für einen alten Mann, der nicht weiss, wieviel Lebenszeit ihm noch bleibt, ist jeder ungestörte Arbeitstag eine Kostbarkeit. Los Angeles habe ich über, weil hier Raucher als perverse Verbrecher dämonisiert werden. Ich möchte in einem Restaurant essen und rauchen können, aber dafür würde ich in diesem Land in Handschellen abgeführt werden. Den Amerikanern ist der Humor ausgegangen, es herrschen Hysterie und Repression.
In Ihrem Atelier liegen Päckchen mit Zigarettenpapier. Drehen Sie auch Zigaretten?
Nein, mit dem Zigarettenpapier drehe ich meinen Joint für den Abend. Cannabis lässt mich lachen und wer lacht, hat keine Angst. Deshalb ist Cannabis gesund.
Werden Sie am Ende des Frühlings nach Los Angeles oder England zurückkehren?
Das weiss ich noch nicht. Reisen ist für mich zu einer Marter geworden. In Flughäfen muss man mich im Rollstuhl umherschieben, weil zwischen Gepäckaufgabe und Flugsteig oft mehrere Meilen liegen. Wie konnte die Menschheit es zulassen, dass Investoren Flughäfen zu Einkaufszentren pervertiert haben?
Eins Ihrer eindringlichsten Selbstporträts zeigt Sie als Schwerhöriger, der sich mit grimmig-verzweifelter Miene eine Hand hinters Ohr hält. Wann haben Ihre Hörprobleme begonnen?
Als ich 1979 mein erstes Hörgerät bekam, hatte ich bereits ein Fünftel meines Hörvermögens verloren. Extreme Schwerhörigkeit isoliert, weil man aufhört zu Partys oder Ausstellungseröffnungen zu gehen. Man fühlt sich von den Menschen abgeschnitten und zieht sich in sich selbst zurück. Nach ein paar Jahren haben Sie das Gefühl, in sich selbst eingesperrt zu sein. Es hat mich immer begeistert, in die Oper oder in klassische Konzerte zu gehen. Heute würde es mich deprimieren, weil ich die hohen und tiefen Töne nicht mehr höre. Ohne Kopfhörer gibt es für mich keine Musik mehr. Hinzu kommt, dass ich Geräusche nicht orten kann. Klingelt ein Telefon, habe ich keine Ahnung, aus welcher Richtung das Klingeln kommt.
Die meisten Ihrer Freunde und Weggefährten sind lange tot. Wie einsam sind Sie?
Ich habe früh damit gerechnet, irgendwann einsam und ohne Liebe zu sein. Das macht es jetzt erträglicher. Wenn die Schwermut mich anfällt, gehe ich ins Atelier und versuche mir einzubilden, es sei meine Pflicht, die Welt mit einem neuen Bild aufzuheitern. Ich wage nicht zu entscheiden, ob Malerei die Welt verändern kann, aber ich weiss aus eigener Erfahrung, dass Kunst Verzweiflung lindern kann. Kunstblinde Menschen gehören wachgeschüttelt.
Halten Sie es allein mit sich aus?
Ich komme mit mir einigermassen zurecht, weil ich es interessant finde, was in meinem Kopf vor sich geht. In diesem Sinn bin ich mir selbst genug. Das heisst aber nicht, dass ich ohne Sehnsucht und Verlangen bin.
Erinnern Sie sich an den Moment, in dem Sie zum ersten Mal dachten: Ich will Künstler werden?
Ich habe schon mit elf gewusst, wer ich bin und wer ich werden will. Woher ich diese Selbstgewissheit nahm, weiss ich nicht, aber sie führte dazu, dass ich mich nie gross um die Meinungen von Professoren, Kritikern und Kuratoren geschert habe. Mein Vater war sein Leben lang Buchhalter und alles andere als ein Revolutionär, aber er schärfte mir schon als Kind ein, ich solle nichts darauf geben, was die Nachbarn über mich sagen. In den Sechzigern malte jeder abstrakt, nur ich nicht, denn etwas in mir sagte, die abstrakte Malerei werde bald an ihr Ende kommen. Dass ich statt konform zu malen meinen eigenen Weg ging, lag auch am Eigensinn meines Vaters.
In den Sechzigern war neben der figurativen Malerei auch das Zeichnen verpönt. Sie brachten es darin zu früher Meisterschaft.
Ich habe es miterlebt, wie Kunsthochschulen aufhörten Zeichnen zu unterrichten. Ein unverzeihlicher Fehler, denn Zeichnen gehört zu den Urin-stinkten des Menschen wie Singen oder Tanzen. Jedes Kind tut es. Ich habe die Ränder meiner Schulhefte mit Cartoons vollgemalt, im Bus zeichnete ich die Gesichter der Fahrgäste auf mein Ticket. Wenn mir zu Hause das Papier ausgegangen war, zeichnete ich mit Kreide auf den Linoleumboden unserer Küche. Der Kommentar meiner Mutter war: «David, denk dran: Nicht auf die Tapeten malen!» Einem Menschen das Zeichnen beizubringen bedeutet, ihm das Sehen beizubringen und seine Sinnlichkeit zu kultivieren. Zeichnen intensiviert unseren Blick und lässt uns Dinge wahrnehmen, die vorher verborgen waren. Dieses entdeckerische Sehen ist um einiges lustvoller als bloss mit trüben Augen das eigene Blickfeld abzuscannen. Ein Turner-Preisträger höhnte mal, Zeichnen sei so veraltet wie auf einem Pferd zur Arbeit zu reiten. Diese Sentenz habe ich gross auf ein Plakat drucken lassen und in mein Atelier gehängt. Viele Jahre später lief der Mann mir über den Weg. Er sagte kleinlaut, sein Pferdevergleich sei eine juvenile Torheit gewesen.
Von 2005 bis 2013 lebten Sie in einem Haus mit Meerblick in Bridlington an der Nordostküste von England. Dort malten Sie auf Ihrem iPhone und iPad Stillleben, die jetzt unter dem Titel My Window als Buch erschienen sind. Wie kamen Sie dazu, Ihr Telefon zur Kunstproduktion zu nutzen?
2009 kaufte ich ein iPhone. Anfangs schaute ich damit hauptsächlich digital animierten Goldfischen zu, aber dann zeigte meine Schwester Margaret mir die App Brushes. Das war die Entdeckung eines neuen künstlerischen Mediums.
Was malten Sie auf Ihrem Glasbildschirm?
Wenn ich aufwachte, malte ich mit meinem Daumen Blumen und mailte sie an 20 Freunde. Es ist doch schön, morgens frische Blumen zu bekommen, die nie verwelken werden. Nach ein paar Wochen malte ich auch Landschaftsdetails und Sonnenaufgänge über dem Meer. Ich fand heraus, wie man die Stärke der Linien variiert und weiche Farbverläufe hinbekommt. In den ersten Wochen vermisste ich den Widerstand des Papiers, aber dafür machte mich das iPhone mutig, weil ich Fehler umstandslos korrigieren konnte. Ein Aquarell dagegen verzeiht dir nicht den kleinsten Missgriff. Mit dem beleuchteten Bildschirm konnte ich frühmorgens ohne künstliches Licht malen und musste noch nicht mal mein Bett verlassen, um Pinsel und Farben zu holen. Wollte ich ein winziges Detail malen, vergrösserte ich den entsprechenden Bildausschnitt mit der Zoomfunktion. Trocknen mussten meine Bildschirmbilder auch nicht.
2010 kauften Sie ein iPad.
Nicht eins, gleich ein halbes Dutzend. Der Bildschirm war achtmal grösser und der Zeichenstift ermöglichte eine grössere Genauigkeit und mehr Differenzierungen als mein Daumen. Was früher mein allgegenwärtiges Skizzenbuch war, wurde fortan das Display meines iPads. Künstler wie van Gogh, William Turner oder Picasso wären von einem iPad begeistert gewesen. Die Farbpalette ermöglicht unendliche Variationen, und beim Malen im Freien kann man auf jede Lichtveränderung sekundenschnell mit einer neuen Farbnuance reagieren. Verblüffend für mich war, dass man mit einem Klick auf den Wiederholungsbutton sich den Malvorgang von der ersten Grundierung bis zum letzten Farbtupfer als Video anschauen konnte, Linie für Linie, Farbschicht für Farbschicht. Es war das erste Mal, dass ich mir beim Malen zusehen konnte. Mein Kopf ist meinem Pinsel um den Bruchteil einer Sekunde voraus, deshalb wusste ich bis dahin nicht, wie ich male. Seit ich diese Videos studiert habe, male ich ökonomischer.
Die 120 Stillleben in My Window zeigen den Blick aus Ihrem Schlafzimmerfenster, von Sonnenblumen über Orchideen und rosa Rosen bis zu schneebedeckten Zweigen…
Sie vermissen in meinen Bildern die Beschissenheit der Welt? Statt für den Brexit fühle ich mich nun mal für das Vorbeiziehen der Jahreszeiten zuständig. Oder nehmen Sie den Schimmer des ersten Tageslichts, das die Welt öffnet: Wer faule Augen hat, dem entlockt das nur ein Achselzucken. Ich dagegen sehe in diesem Schimmer ein grandioses Schauspiel mit ständig wechselnden Feinheiten.
Sie waren 2010 der erste namhafte Künstler, der eine grosse Ausstellung ausschliesslich mit iPhone- und iPad-Bildern bestritt. Wunderte es Sie, dass kein jüngerer Kollege auf diese Idee gekommen war?
Nein, denn bestimmte technische Erfindungen befeuern auf Anhieb meine Phantasie. Das fing in den Achtzigern an, als ich für meine Arbeiten Computer, Polaroids, Videokameras, Adobe Photoshop, Laserkopierer und Faxgeräte benutzte. 1989 hatte ich in Brasilien eine Ausstellung, die nur aus Bildern bestand, die ich gefaxt hatte. Die Welt mein Leben lang durch dieselbe Linse anzuschauen, würde die Welt entzaubern und käme mir wie ein langes Sterben vor. Mit technischen Erfindungen auf eine neue Art zu sehen, bedeutet eine neue Art zu fühlen kennenzulernen. Das ist für mich eine Wiederverzauberung der Welt, weil Gewissheiten auf einmal nicht mehr gelten. Es ist die Weigerung, sich selbst zu kopieren, die einen Künstler vor-anbringt. Ich will auf meinen Bildern etwas so zeigen, als würde es mit grossen Augen zum ersten Mal angeschaut werden. Wie soll man andere überraschen, wenn man sich selbst nicht mehr überraschen lassen kann?
Wo liegt Ihr gefühltes Alter?
Im Atelier bin ich 30. Wenn ich es verlasse fühle ich mich wie 82, griesgrämig und von Wehwehchen geplagt. Auch diese Diskrepanz treibt mich jeden Morgen ins Atelier. Verlöre ich die Fähigkeit zu malen, brächte ich mich wahrscheinlich um wie mein Freund R.B. Kitaj. Er hatte Parkinson. Der qualvollste Albtraum eines Malers ist, dass seine Hände zu zittern beginnen. Das wäre sein Ende.
Wie werden Sie wissen, wann es Zeit ist mit dem Malen aufzuhören?
Nach meinem Eindruck sterben die meisten Alten an Langeweile. Gänsehaut und Freudentränen sind für sie bloss noch Worte. Ihre Neugier ist erloschen und die leere Routine ihres Alltags führt zu Überdruss und Trostlosigkeit. Ich dagegen will immer noch überrascht werden und Entdeckungen machen, weil ich die Welt schön, aufregend und geheimnisvoll finde. Ich male seit meiner Kindheit, aber ich weiss bis heute nicht was mein Pinsel in der nächsten Sekunde tun wird. Der Tag, an dem ich vor einer Leinwand keine Neugier mehr empfinde, wird der Tag sein, an dem ich mich selbst in Pension schicke. Bis dahin freue ich mich über die Ankunft des Frühlings. Wie Frank sang: «I did it my way.»